voneinander und miteinander Sprachen lernen und erleben
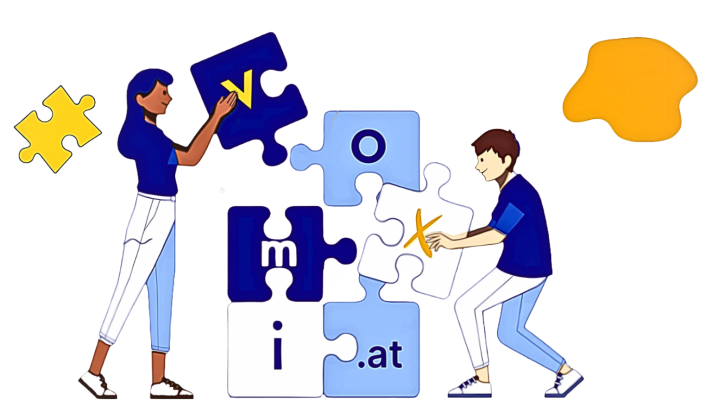
Eingabehilfen öffnen
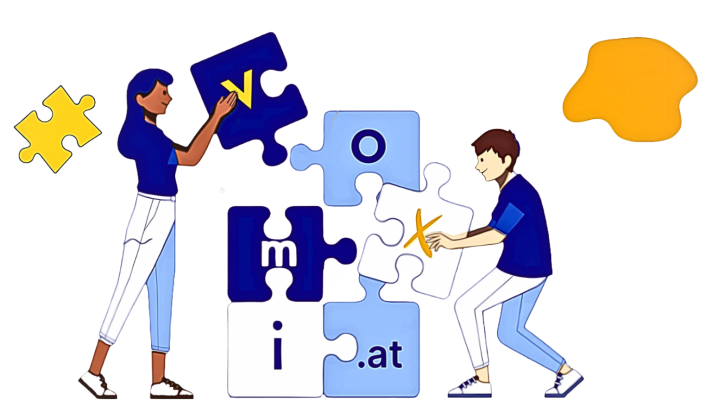
Die hier zur Verfügung gestellten Materialien dienen als Anregung, wie sprachliche Vielfalt in elementarpädagogischen Bildungsinstitutionen wertgeschätzt, unterstützt und gefördert werden kann.
Die Beiträge wurden für die drei Zielgruppen Kinder – Eltern – pädagogisches Team konzipiert, mit dem Ziel, (1) Mehrsprachigkeit sichtbar zu machen, (2) wertschätzend mit den vielen Sprachen der Kinder umzugehen und (3) Impulse für eine frühe sprachliche Förderung unter Einbeziehung aller Sprachen der Kinder zu setzen.
Alle Beiträge wurden von Studierenden des berufsbegleitenden Bachelorstudiums Elementarbildung: Inklusion und Leadership der Pädagogischen Hochschule Wien entwickelt und auch in der eigenen Praxis – im Rahmen der elementarpädagogischen Bildungsarbeit in unterschiedlichen Kindergärten – erprobt. Die Beträge können beliebig unter- oder miteinander kombiniert werden – über Feedback freuen wir uns.
Oft werden Informationsaushänge für Eltern am Gang oder in der Garderobe aufgehängt. Meistens sind die Inhalte dazu auf Deutsch formuliert, jedoch sprechen nicht alle Elternteile die gleiche Sprache. Für einen inklusiven Gedanken ist es jedoch wichtig, dass alle Eltern die Möglichkeit haben, sich die Informationen anzueignen. Daher können Elternaushänge in mehrsprachiger Form gestaltet werden.
In diesem Beispiel wurden Karten gestaltet, auf denen die Inhalte (beispielsweise pädagogische Inhalte bzgl. einer Cremerutsche, Aktionstabletts) verschriftlicht wurden. Auf einer Karte war der Text auf Deutsch, auf einer anderen auf Englisch und auf wieder anderen in weiteren Sprachen geschrieben. So können immer jene Karten aufgehängt werden, die aktuell benötigt werden. Sie können außerdem aufgehoben und in den Folgejahren erneut genutzt werden.
Ein Beitrag von Helene Bosters
Kinder interessieren sich bereits früh für andere Sprachen und Schriften. Meist wissen sie, dass bestimmte Kinder in ihrer Gruppe eine andere Muttersprache oder Erstsprache sprechen, kennen jedoch nur die lateinische Schrift, da diese in Österreich gebraucht wird. Das Angebot zielt darauf aus, Schriften und Begrüßungen aus anderen Ländern kennenzulernen.
Zuerst geht man mit dem Finger auf der Landkarte auf die Reise.
Gemeinsam besucht man Länder, aus denen die Familie der Kinder
stammen oder die sie bereits besucht haben.
Anschließend stellt die Pädagogin verschiedene Schriften vor und
spricht vor, wie man das geschriebene Wort ausspricht. Alle Wörter des
Angebots sind Begrüßungen in der Landessprache. Die Schriften und
Sprachen spiegeln die Diversität der Kinder in der Gruppe wider.

„Alltagsintegrierte Sprachförderung bedeutet, die eigene Sprache und die der Kinder im Alltag nicht dem Zufall zu überlassen.“ (Zwetelina Ortega) Eine kompetente Förderung von Mehrsprachigkeit für junge Kinder ist daher das Anliegen des Handbuchs zur institutionellen Mehrsprachigkeit in Kindergarten u. Schule HANDBUCH Sprachen_Stand 2022, welches die Wiener Kinderfreunde im Rahmen des INTERREG Projekts BIG „Bildungskooperation in der Grenzregion gemeinsam mit der Bildungsdirektion für Wien herausgegeben haben.
„Sprich mit mir und hör mir zu“ heißt eine Broschüre, die in vielen Sprachen Anleitungen enthält, wie Eltern ihre Kinder beim Sprechenlernen unterstützen können. Diese sehr gelungene Elternbroschüre wurde in viele Sprachen übersetzt. In den Sprachen BKS, Deutsch, Türkisch, Englisch, Ungarisch, Slowakisch und Tschechisch ist sie unter https://eu.wien.kinderfreunde.at/materialien/mehrsprachiger-elternratgeber als Download verfügbar.
Für die institutionelle Umsetzung einer qualitätvollen Sprachlichen Bildung haben die Wiener Kinderfreunde in einem grenzübergreifenden Projekt gemeinsam mit Partnern in der Slowakei, der Tschechischen Republik und Ungarn auch Qualitätsstandards entwickelt: 1.L.WEB Sprachbaum_finaleversion
Eine Reihe von wertvollen Informationen, Tipps und Impulsen für eine inklusive Arbeit mit der Sprachenvielfalt der Kinder in der elementaren Bildung findet sich auf der Homepage dieses INTERREG Projets unter www.big-projects.eu sowie unter https://eu.wien.kinderfreunde.at/materialien.
Das Lied „Ich lieb den Frühling“ wird zum Frühlingsbeginn in der Gruppe mit den Kindern erarbeitet. Dazu werden die Bildkarten in die Mitte gelegt und die Motive besprochen. Zuerst wird das Lied auf Deutsch gesungen. Beim Singen des Liedes in der Fremdsprache Englisch muss beachtet werden, dass die Wörter bzw. der Text vorab Schritt für Schritt erklärt werden soll.
Das Kamishibai bietet eine gute Möglichkeit Kinder aktiv bei der Erzählung einer Geschichte mit einzubeziehen. Bei diesem Angebot versammelt sich die Pädagogin mit den Kindern im Morgenkreis. Es wird die erste Seite der Kamishibai Geschichte gezeigt und gemeinsam wird überlegt was auf dem ersten Bild zu sehen ist. Hierbei werden die Begriffe zuerst auf Deutsch besprochen und dann auf Englisch. Im Anschluss dürfen die Kinder die Begriffe in all ihren Familiensprachen benennen und gemeinsam mit der Gruppe werden diese wiederholt. Im Anschluss wird die Geschichte auf Deutsch erzählt.
Nach der Geschichte wird die Handpuppe gerufen und mit den Kindern wird der Inhalt der Geschichte noch einmal besprochen. Hierbei werden Bildkärtchen mit den Kindern bearbeitet, auf denen sich die Hauptbegriffe der Erzählung befinden. Die Kinder wiederholen nun erneut gemeinsam die Begriffe in den verschiedenen Sprachen.
Das Kamishibai sowie die Bildkärtchen stehen für die Kinder jederzeit zur Verfügung wodurch sie selbstständig die Geschichte nacherzählen können.
Die Geschichte der drei Schmetterlinge mit dem Kamishibai erzählt
Ein mehrsprachiges Bilderbuch soll gemeinsam mit Hilfe der Eltern gestaltet werden. Das Buch „Heute bin ich“ wird zuerst in der elementaren Bildungseinrichtung mit den Kindern gelesen und erarbeitet. Ältere Kinder zeichnen die Fische mit den jeweiligen Gesichtsausdrücken. Mit den Zeichnungen der Kinder wird in der Garderobe eine Wandzeitung gestaltet.
Hier geht es zu einer detaillierten Beschreibung: Gestaltung eines mehrsprachigen Bilderbuches
Kinder können den Verlauf einer Geschichte anhand von Figuren und Gegenständen, die je nach Handlungsablauf der Erzählung aus dem Säckchen hervorgeholt werden, genau beobachten und verfolgen. Dies bietet die Möglichkeit zum Mitsprechen in verschiedenen Sprachen sowie Zeit, um Fragen zu stellen und zu beantworten. Kurze, gereimte Textpassagen, lautmalende Wörter in Verbindung mit Handlungen, die mit einer einfachen Kulisse oder Gegenständen aus dem Säckchen ausgeführt werden, erleichtern den Kindern den Ablauf und Inhalt einer kurzen Geschichte zu verstehen und zu festigen.
Kinder haben die Möglichkeit sich mit dem Bilderbuch zu identifizieren,
da Gefühle ein allgegenwärtiges Thema darstellen und jedes einzelne Kind betreffen. Den Kindern wird dabei die Möglichkeit geboten sich mit
ihren eigenen Gefühlen sowie mit den Gefühlen der anderen zu
beschäftigen und dabei ihre Empathie Fähigkeit auszubauen.
Über die Sprache und das Sprechen tauchen die Kinder in die lebensnahe
Welt der Gefühle ein. Sie werden erfahren über eigene Gefühle zu
sprechen, Gefühle zu hinterfragen, Erlebtes und Erfahrenes
Wiederzugeben und darüber hinaus spielerisch und kreativ tätig zu werden.
Hier geht es zur Beschreibung: Das Farbenmonster
Um die Begriffe zu klären, bespricht man vorab die Bilder mit den Kindern. Kinder mit anderen Erstsprachen als Deutsch sagen diese in ihren Sprachen und wir wiederholen die Wörter gemeinsam.
Das Spiel wird aufgebaut und jedes Kind legt seine fünf Steine auf die selbst ausgewählten Begriffe des eigenen Sprachbingos.
Ablauf:
Das jüngere Kind darf beginnen und fragt mit dem Satz: Hast du, bitte, auf dem (Name des Bildes) einen Stein liegen?
Das zweite Kind antwortet mit „Ja“ oder „Nein“.
Bei der Antwort „Ja“ wird der Stein dem fragenden Kind gegeben und das zweite Kind ist an der Reihe.
Bei der Antwort „Nein“ ist das zweite Kind umgehend an der Reihe.
Ende: Das Kind, das zuerst alle Steine des/der Spielpartner*in gesammelt hat, hat gewonnen.
Liebe Leser und Leserinnen!
Hier können Sie ein paar Ideen finden, wie ein Elternabend zum Thema Mehrsprachigkeit gestaltet werden kann:
Elternabend zu Mehrsprachigkeit
Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren!
Vivien Pfeiffer
Um Kindern ohne Deutschkenntnissen und deren Eltern die Eingewöhnung in der Kleinkindgruppe bzw. in der Kindergartengruppe zu erleichtern, werden Bildkarten und Wortschatzlisten eingesetzt. Diese sollen bei der Orientierung im Gruppenraum helfen.
Die Ausgabe der Bildkarten und die Wortschatzliste werden den Eltern vor der Eingewöhnung übermittelt mit der Bitte, die Bildkarten in der Wohnung an den passenden Stellen anzubringen. Zu Hause können die Eltern nun die Bildkarten mit den Kindern besprechen. Die Wortschatzliste soll mit den entsprechenden Begriffen in den Erstsprachen ausgefüllt und am ersten Eingewöhnungstag mitgebracht werden.
Diese Wortschatzliste dient der Pädagogin oder dem Pädagogen dazu, die Bedürfnisse der Kinder besser zu verstehen. Eine identische Ausgabe der Bildkarten wird rechtzeitig zur Eingewöhnung des Kindes in der Gruppe an den entsprechenden Orten aufgehängt. Diese Bildkarten dienen den Kindern zur besseren Orientierung, stellen ein vertrautes Bindeglied zwischen dem bekannten Wohnbereich und der noch unbekannten Umgebung im Kindergarten dar und erleichtern den Kindern das Mitteilen ihrer Bedürfnisse.
Bildquelle: Simon Preiner
Unterstützung der Eingewöhnung mit Bildkarten und Wortschatzlisten
Elterngespräche sind ganz wichtig und notwendig. Diese müssen immer wieder geführt werden. Sie dienen der gegenseitigen Information, der aktiven Bildungspartnerschaft, fördern die Transparenz, können helfen bei der Förderung von Kinder mit besonderen Bedürfnissen wie z. B. bei Autismus, ADHS. Der Anlass für ein wichtiges Elterngespräch kann sein, dass die Eltern ein Anliegen, Wünsche, Ideen haben, Informationen benötigen oder eine Beschwerde eingebracht haben und diese nun mit den Eltern besprochen werden soll/muss. Dann kann auch als Anlass für ein Gespräch mit den Eltern sein, dass der/die Pädagogin/Pädagoge mit den Eltern etwas in Ruhe besprechen (Entwicklungsgespräch, Therapie Info, Anliegen, Zusammenarbeit, Hilfe/Mitarbeit/Unterstützung, …) möchte.
Damit dem Gespräch Raum und Zeit gegeben werden kann, muss ein Termin vorab vereinbart werden. Dieser Termin muss für alle TeilnemerInnen gut passen (Tageszeit, ohne Kinder, Raum…). In fast allen Wiener Bezirken sind Kinder unterschiedlicher Nationalitäten, unterschiedlicher sprachlicher und kultureller Herkunft vertreten. Es gibt viele Kinderbetreuungseinrichtungen, in denen viele Kinder und Eltern wenig bis kein Deutsch verstehen oder sprechen. Beispiel: In unserem Kindergarten gibt es nur zwei Kinder mit DAE (von 130 Kindern). Das ist eine große Herausforderung für alle GesprächspartnerInnen. Informationen über die Erstsprache der Eltern/GesprächspartnerInnen müssen eingeholt werden. Auf den meisten Anmeldeformularen sind die Erstsprachen der Kinder und die Erstsprachen der Eltern angegeben. Fehlen diese Angaben, dann müssen die Eltern gefragt werden. Es genügt nicht nur die Erstsprachen zu ermitteln, sondern es muss auch das Sprachniveau erfragt werden. Davon hängen die Wortwahl und die Vorbereitung auf das Gespräch ab. Je geringer die Deutschkenntnisse, umso einfachere Wörter und Satzstrukturen müssen im Gespräch verwendet werden. Hilfreich ist es, sich einen Gesprächsleitfaden (Stichworte) zu erstellen. Dieser dient der Unterstützung beim Gespräch. Es können eigene einfache Notizen sein oder ein vorgefertigter Gesprächs-Leitfaden zum Ausfüllen. Die meisten LeiterInnen haben solche im Büro aufliegen.
Es ist optional sich einen Leitfaden zu erstellen. Er hilft, beim Thema zu bleiben, die einfachen Worte zu haben, keine Eckdaten zu vergessen, allgemeine und spezielle themenbezogene Infos zur Hand zu haben, sich zu fokussieren, sensibilisieren, Elterninfos gleich zur Hand zu haben, auch bekannte private Infos aus früheren Gesprächen notiert zu haben.
All das hilft, das Gespräch positiv zu beeinflussen, vermittelt den GesprächspartnerInnen Interesse, Wertschätzung, Achtsamkeit sowie Aufmerksamkeit von Seiten des Pädagogen/der Pädagogin, (ist hilfreich um eine gute Beziehung und Gesprächsatmosphäre aufzubauen, ….). Die eigenen Ziele müssen klar, kurz, prägnant, erreichbar, zeitnahe und bewertbar sein. Informationen zum Thema der Eltern sollte eingeholt werden. Geht es z. B. um ein autistisches Kind, dann müssen allgemeine und spezielle Infos darüber vorab eingeholt werden. Geht es um eine Beschwerde, sollten vorab schon lösungsorientierte Ansätze überlegt und vorbereitet werden. Das hilft, das Gespräch positiv zu führen, positiv zu beeinflussen, hebt die Kooperationsbereitschaft und ermöglicht, im zeitlichen Rahmen bleiben zu können.
Ein geeigneter (Zeit, Größe, Corona Hygienerichtlinien Tauglichkeit, …) Raum muss ermittelt werden. Es muss der zeitliche Rahmen festgelegt werden. Dieser muss beim Festlegen des Termins fixiert werden und zum Gesprächsbeginn auch noch einmal angesprochen werden. Es sollte auf keinen Fall eine Stunde überschreiten. Die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne für ein intensives und schwieriges Gespräch ist damit erreicht. Gut ist es, wenn ein Teammitglied die Erstsprache der GesprächspartnerInnen spricht. Wenn dies nicht der Fall ist und die Deutschkenntnisse der Eltern sehr gering sind, sollte eine Übersetzer-App aufs Handy geladen werden. In ganz schwierigen fällen, kann ein Dolmetsch Service von der Stadt Wien genützt werden. Es gibt kostenlose und kostenpflichtige. Welches zum Einsatz kommen kann/darf, wird von der Leitung und von der Verfügbarkeit abhängen. Es ist gut zu wissen, dass wir damit nicht alleine sind. Es ist genau darauf zu achten, dass das Gespräch ungestört ablaufen kann. Wichtig ist auch, dass alle Handys abgeschaltet sind. Auf Vibrieren zu stellen ist ebenfalls zu vermeiden. Es stört, wenn immer wieder ein Handy summt, surrt oder vibriert, das lenkt ab. Einzige Ausnahme darf sein, wenn am Handy des Pädagogen/der Pädagogin die Übersetzer App hochgeladen wurde/werden musste.
Wichtige Eltern Gespräche im Kindergarten – mehrsprachig oder Deutsch als Fremdsprache
Der Teamworkshop an einer Institution der elementaren Bildung bietet die Möglichkeit, das Team an das Thema „Mehrsprachigkeit“ heranzuführen und sich erstmals genauer damit auseinanderzusetzen. Es geht darum, welche Bedeutung Mehrsprachigkeit aus ganzheitlicher Sicht hat, welche (Vor)Erfahrungen
es dazu im Team gibt, welche Ressourcen es zur Umsetzung in der Bildungseinrichtung gibt und erste SMART-Ziele dafür zu formulieren. Eine regelmäßige Teamreflexion/Evaluierung, Weiterbildung und
Auseinandersetzung in weiteren Teamworkshops (oder an pädagogischen Tagen) ist nötig.
Bildquelle: Katharina Antolkovich-Swoboda